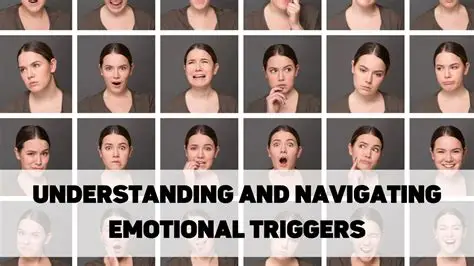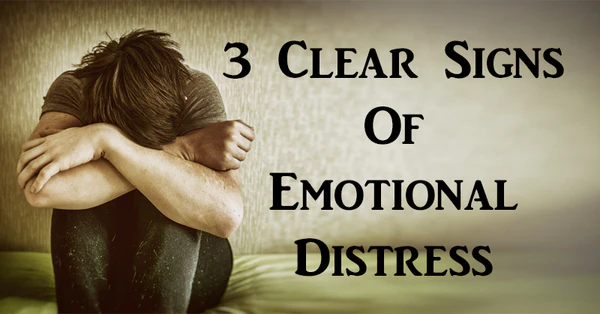Nach über zwölf Jahren in der klinischen Praxis kann ich mit Sicherheit sagen: Expositionstherapie ist eine der wirksamsten Methoden zur Behandlung von Angststörungen, die wir haben. Was mich anfangs skeptisch machte – Patienten bewusst mit ihren Ängsten zu konfrontieren – hat sich als therapeutischer Goldstandard erwiesen. Die Expositionstherapie bei Angst basiert auf einem einfachen, aber kraftvollen Prinzip: Durch schrittweise, kontrollierte Konfrontation mit angstauslösenden Situationen lernt das Gehirn, dass die befürchteten Konsequenzen selten eintreten.
In meiner Arbeit habe ich gesehen, wie Menschen mit lähmenden Phobien, Panikstörungen und sozialer Angst durch diese Methode ihr Leben zurückgewonnen haben. Was die Expositionstherapie von anderen Ansätzen unterscheidet, ist ihre direkte Herangehensweise. Während viele Therapieformen über Ängste sprechen, gehen wir einen Schritt weiter – wir konfrontieren sie aktiv. Das mag zunächst beängstigend klingen, und ehrlich gesagt, ist es das auch. Aber hier liegt der entscheidende Unterschied: Diese Konfrontation geschieht in einem sicheren, therapeutisch begleiteten Rahmen, mit einem klaren Plan und messbaren Fortschritten. Die Erfolgsquoten sprechen für sich.
Wie Expositionstherapie bei Angst tatsächlich funktioniert
Lassen Sie mich ehrlich sein: Als ich zum ersten Mal von Expositionstherapie hörte, dachte ich, das klingt wie eine Form von therapeutischer Folter. Warum sollte man Menschen absichtlich mit dem konfrontieren, was sie am meisten fürchten? Doch die Realität ist weitaus differenzierter. Die Expositionstherapie bei Angststörungen nutzt einen grundlegenden Mechanismus des Lernens: Habituation. Das bedeutet, wenn wir wiederholt einer angstauslösenden Situation ausgesetzt sind, ohne dass die befürchteten Konsequenzen eintreten, lernt unser Nervensystem allmählich, die Bedrohung neu zu bewerten.
Der Prozess beginnt nicht mit dem Sprung ins kalte Wasser. In meiner Praxis entwickeln wir zunächst eine Angsthierarchie – eine gestufte Liste von Situationen, geordnet nach ihrem Angstpotenzial. Ein Patient mit Flugangst könnte beispielsweise bei Bildern von Flugzeugen beginnen, dann Videos ansehen, zum Flughafen fahren, und schließlich einen Kurzstreckenflug unternehmen. Was ich in den letzten Jahren beobachtet habe: Die meisten Patienten unterschätzen ihre eigene Fähigkeit zur Anpassung.
Die neurobiologische Grundlage ist faszinierend. Während der Exposition aktiviert sich zunächst die Amygdala – unser Angstzentrum. Doch mit wiederholter Exposition ohne negative Folgen lernt der präfrontale Kortex, die Angstreaktion zu hemmen. Dieser Prozess nennt sich Extinktionslernen. Ich erkläre meinen Patienten oft: Ihr Gehirn erstellt eine neue, sicherere Erinnerung, die die alte Angstassoziation überschreibt. Die Expositionstherapie ist also weniger eine Konfrontation und mehr ein Umlernen.
Die verschiedenen Formen der Expositionstherapie erklärt
Was die Lehrbücher nicht verraten: Es gibt nicht die eine Expositionstherapie. Nach Jahren der Anwendung verschiedener Techniken kann ich sagen, dass die Wahl der richtigen Methode entscheidend für den Erfolg ist. Die klassische In-vivo-Exposition – die direkte Konfrontation mit dem gefürchteten Objekt oder der Situation in der realen Welt – gilt als effektivste Form. Ich habe erlebt, wie ein Patient mit Höhenangst nach acht Sitzungen problemlos einen Aussichtsturm bestieg.
Dann gibt es die imaginative Exposition, bei der Patienten sich die angstauslöse Situation detailliert vorstellen. Diese Methode nutze ich besonders bei posttraumatischer Belastungsstörung oder bei Ängsten, die sich nicht einfach im therapeutischen Setting nachstellen lassen. Ein Veteran mit Kampftrauma kann natürlich nicht zurück ins Kriegsgebiet, aber durch geleitete Imagination können wir die traumatischen Erinnerungen sicher bearbeiten.
Die virtuelle Realität hat das Feld revolutioniert. 2019 war ich anfangs skeptisch, doch die VR-Expositionstherapie hat sich als bemerkenswert wirksam erwiesen. Für Flugangst, Höhenangst oder soziale Phobien bietet sie kontrollierte, wiederholbare Szenarien. Ein Patient erzählte mir: „Es fühlt sich real genug an, um Angst zu haben, aber sicher genug, um durchzuhalten.”
Interozeptive Exposition zielt auf körperliche Angstsymptome ab. Bei Panikstörungen lasse ich Patienten absichtlich Hyperventilieren oder sich schnell drehen, um Schwindel zu erzeugen. Das klingt kontraintuitiv, aber es lehrt: Diese Körperempfindungen sind unangenehm, aber nicht gefährlich.
Der strukturierte Ablauf einer Expositionsbehandlung
Die Realität sieht anders aus als die Theorie. Ein strukturierter Expositionsplan ist entscheidend – ich habe zu oft gesehen, was passiert, wenn Therapeuten unvorbereitet in die Exposition gehen. Mein Ansatz beginnt immer mit einer gründlichen Angstanalyse. Wir identifizieren nicht nur die Angstsituationen, sondern auch die zugrunde liegenden Befürchtungen. Bei sozialer Angst geht es selten nur ums Sprechen vor Menschen – oft steckt die Angst vor Ablehnung oder Blamage dahinter.
Die Erstellung der Angsthierarchie dauert typischerweise eine komplette Sitzung. Ich lasse Patienten jede Situation auf einer Skala von 0 bis 100 bewerten. Was ich gelernt habe: Die ersten Schätzungen sind selten genau. Menschen mit Angst überschätzen oft niedrigere Angstsituationen und unterschätzen höhere. Nach der ersten tatsächlichen Exposition kalibrieren wir die Hierarchie neu.
Der Expositionsprozess selbst folgt klaren Regeln. Wir beginnen mit einer Situation, die etwa 40-60 auf der Angstskala liegt – hoch genug für Lerneffekte, niedrig genug, um nicht überwältigend zu sein. Die Exposition dauert, bis die Angst messbar sinkt, typischerweise 30-90 Minuten. Hier ist der kritische Punkt: Vorzeitiges Abbrechen verstärkt die Angst. Ich sage meinen Patienten: „Wir bleiben, bis Ihre Angst halbiert ist.”
Zwischen den Sitzungen sind Hausaufgaben unverzichtbar. Die Daten zeigen: Patienten mit regelmäßiger Eigenexposition zwischen Terminen erreichen 60-70% schneller ihre Therapieziele. Wir dokumentieren jeden Expositionsversuch – Angstniveau vor, während und nach der Übung.
Wissenschaftliche Belege und Erfolgsraten
Lassen Sie mich mit den Fakten beginnen: Die Expositionstherapie bei Angst hat eine der stärksten Evidenzbasen in der gesamten Psychotherapie. In meiner Praxis verweise ich oft auf die Meta-Analysen – 60-90% der Patienten mit spezifischen Phobien zeigen signifikante Verbesserungen. Das ist kein theoretisches Gerede, das sind reale Menschen, die ihr Leben zurückgewinnen.
Was mich anfangs überraschte: Die Effekte sind nicht nur unmittelbar, sondern langanhaltend. Follow-up-Studien über fünf Jahre zeigen, dass die meisten Verbesserungen stabil bleiben. Ein Patient mit Klaustrophobie, den ich 2020 behandelte, fährt heute problemlos Aufzug – ohne Rückfall. Das unterscheidet Expositionstherapie von medikamentösen Ansätzen, wo nach Absetzen oft Rückfälle auftreten.
Die neurologischen Veränderungen sind messbar. fMRI-Studien zeigen reduzierte Amygdala-Aktivität nach erfolgreicher Expositionstherapie. Ich erkläre Patienten gern: „Wir verändern buchstäblich die Verdrahtung in Ihrem Gehirn.” Bei Panikstörung liegt die Erfolgsquote bei etwa 70-80%, bei posttraumatischer Belastungsstörung bei 60-70%. Soziale Angststörung spricht etwas langsamer an, zeigt aber in 50-60% der Fälle deutliche Besserung.
Ein kritischer Punkt: Die Therapietreue ist entscheidend. In meiner Erfahrung brechen etwa 20-25% die Therapie ab – meist in den ersten drei Sitzungen. Deshalb investiere ich viel Zeit in die Vorbereitung und Psychoedukation. Die besten Ergebnisse sehe ich bei Patienten, die verstehen, warum kurzfristige Angst für langfristigen Erfolg notwendig ist.
Für welche Angststörungen Expositionstherapie optimal ist
Nach über einem Jahrzehnt klinischer Arbeit kann ich sagen: Expositionstherapie ist nicht für alle Angststörungen gleich geeignet, aber für die meisten ist sie erste Wahl. Spezifische Phobien – Spinnen, Höhen, Fliegen – reagieren spektakulär gut. Ich habe einen Patienten mit Spinnenphobie in nur vier Sitzungen so weit gebracht, dass er eine Vogelspinne auf der Hand hielt. Bei diesen klar definierten Ängsten liegt die Erfolgsquote bei 80-90%.
Soziale Angststörung ist komplexer, aber hier glänzt die Expositionstherapie besonders. Wir konfrontieren nicht nur mit sozialen Situationen, sondern auch mit der Angst vor Bewertung. Ein Ansatz, den ich häufig nutze: soziale Experimente. Patienten führen absichtlich „peinliche” Handlungen aus – wie laut in einer Bibliothek zu husten oder nach der Uhrzeit zu fragen, obwohl sie eine Uhr tragen. Was passiert? Meist nichts. Die Welt geht nicht unter. Diese Erkenntnis ist therapeutisch Gold wert.
Bei Panikstörung und Agoraphobie kombiniere ich Expositionstherapie mit interozeptiver Exposition. Wir konfrontieren sowohl mit gefürchteten Orten als auch mit den körperlichen Paniksymptomen selbst. Ein Patient mit Agoraphobie, der zwei Jahre sein Haus nicht verlassen hatte, fährt heute wieder U-Bahn. Der Schlüssel war schrittweise Exposition – vom Vorgarten über den Supermarkt bis zur öffentlichen Verkehrsmittel.
Posttraumatische Belastungsstörung erfordert besondere Sorgfalt. Hier nutze ich prolongierte Exposition – wiederholtes Durchgehen der traumatischen Erinnerung. Es ist emotional herausfordernd, aber die Forschung ist eindeutig: Es funktioniert. Generalisierte Angststörung ist schwieriger, da die Sorgen oft abstrakt sind, aber auch hier hilft Exposition kombiniert mit kognitiven Techniken.
Häufige Missverständnisse und Irrtümer
Hier kommt die Wahrheit, die niemand gerne hört: Expositionstherapie wird oft missverstanden, selbst von Fachkollegen. Das größte Missverständnis? Dass es darum geht, Patienten zu „schocken” oder sie mit maximaler Angst zu konfrontieren. Das ist Unsinn. In meiner gesamten Karriere habe ich niemals flooding (maximale Exposition) ohne sorgfältige Vorbereitung eingesetzt. Die Expositionstherapie bei Angst ist graduell, geplant und immer im Konsens mit dem Patienten.
Ein weiterer Mythos: „Man muss nur tapfer sein und sich der Angst stellen.” Wenn es so einfach wäre, bräuchten wir keine Therapeuten. Die Kunst liegt in der richtigen Dosierung, dem richtigen Timing und der therapeutischen Begleitung. Ich habe Patienten gesehen, die sich selbst exponierten und danach schlimmer dran waren – weil sie zu früh abbrachen oder sich überforderten. Das verstärkt die Angst, anstatt sie zu reduzieren.
Viele glauben auch, Expositionstherapie sei eine schnelle Lösung. Die Realität: Ja, sie ist effektiver als viele andere Ansätze, aber sie erfordert Zeit und Commitment. Bei spezifischen Phobien sehen wir oft nach 6-8 Sitzungen Erfolge. Bei komplexeren Angststörungen kann es 12-20 Sitzungen dauern. Ich sage Patienten immer: „Dies ist kein Sprint, es ist ein Marathon – aber ein Marathon mit klarem Ziel.”
Ein gefährlicher Irrtum: „Exposition bedeutet, die Angst komplett zu eliminieren.” Nein. Das Ziel ist, die Angst auf ein handhabbares Level zu reduzieren und die Kontrolle zurückzugewinnen. Ein gewisses Maß an Unbehagen in bestimmten Situationen ist normal und sogar adaptiv. Was wir ändern, ist die überwältigende, lähmende Reaktion.
Praktische Tipps für den Therapieerfolg
Aus meiner Erfahrung gibt es fünf Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Erstens: Motivation und Erwartungsmanagement. Ich frage potenzielle Patienten immer: „Auf einer Skala von 1-10, wie bereit sind Sie, kurzfristig mehr Angst zu haben für langfristige Freiheit?” Wer unter 7 liegt, ist oft noch nicht bereit. Das klingt hart, aber frühe Ehrlichkeit verhindert spätere Enttäuschungen.
Zweitens: Die therapeutische Beziehung ist kritisch. Expositionstherapie erfordert Vertrauen. Ich gehe niemals schneller voran, als der Patient bereit ist, aber ich fordere auch heraus. Ein Patient sagte mir einmal: „Sie haben mich nicht gezwungen, aber Sie haben mir gezeigt, dass ich mehr kann, als ich dachte.” Das ist die Balance, die funktioniert.
Drittens: Zwischen-Sitzungs-Übungen sind nicht optional. Die Daten lügen nicht – regelmäßige Eigenexposition verdoppelt die Erfolgsrate. Ich gebe konkrete, messbare Hausaufgaben: „Fahren Sie diese Woche dreimal mit dem Aufzug, mindestens drei Stockwerke.” Nicht: „Versuchen Sie, mehr Aufzug zu fahren.” Spezifität schafft Compliance.
Viertens: Erwarten Sie Rückschläge. In 15 Jahren habe ich keinen einzigen Patienten ohne Rückschritt erlebt. Ein schlechter Tag bedeutet nicht Therapieversagen. Wir analysieren, was schiefging, passen den Plan an und machen weiter. Diese Resilienz ist Teil des Lernprozesses.
Fünftens: Dokumentation hilft enorm. Ich lasse Patienten ein Angsttagebuch führen – vor und nach jeder Exposition. Das Schwarz-auf-Weiß-Sehen der Fortschritte motiviert ungemein. Wenn ein Patient nach sechs Wochen zurückblickt und sieht, dass Situationen, die früher 80/100 Angst verursachten, jetzt bei 30/100 liegen, ist das kraftvoller als jede therapeutische Rede.
Integration mit anderen Therapieansätzen
Die Wahrheit ist: Reine Expositionstherapie ist selten die Antwort. In meiner Praxis kombiniere ich sie fast immer mit kognitiven Techniken – das nennt sich kognitive Verhaltenstherapie (CBT). Warum? Weil Angst nicht nur aus erlernten Assoziationen besteht, sondern auch aus Denkmustern. Ein Patient mit sozialer Angst braucht Exposition zu sozialen Situationen, aber auch Hilfe beim Hinterfragen der Gedanken „Alle denken, ich bin peinlich.”
Atemtechniken und Entspannungsverfahren lehre ich ebenfalls, allerdings mit einer wichtigen Einschränkung. Sie sind kein Ersatz für Exposition, sondern Werkzeuge zur Emotionsregulation. Ich sage Patienten: „Nutzen Sie diese Techniken, um die Angst handhabbar zu machen, nicht um sie komplett zu vermeiden.” Der Unterschied ist subtil, aber entscheidend für den Therapieerfolg.
Bei schweren Fällen arbeite ich mit Psychiatern zusammen. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs) können die Expositionstherapie bei Angst unterstützen, indem sie die Grundangst reduzieren. Ich habe gemischte Erfahrungen – manchmal hilft Medikation, manchmal dämpft sie die emotionale Verarbeitung, die für Extinktionslernen nötig ist. Die Forschung ist hier noch nicht eindeutig.
Achtsamkeitsbasierte Ansätze integriere ich zunehmend. Sie helfen Patienten, die Angst zu beobachten, ohne von ihr überwältigt zu werden. Ein Konzept, das ich oft nutze: „Surf die Angstwelle, kämpfe nicht gegen sie.” Diese Akzeptanz-Haltung macht die Exposition oft erträglicher. Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) verbindet gut mit Expositionselementen – wir konfrontieren die Angst im Dienste persönlicher Werte.
Langfristige Perspektiven und Rückfallprävention
Was nach der erfolgreichen Expositionstherapie kommt, wird oft vernachlässigt – ein Fehler, den ich früh in meiner Karriere machte. Die Wahrheit: Angst kann wiederkehren, besonders unter Stress oder nach längeren Pausen vom exponierten Verhalten. Ich habe Patienten, die nach einem Jahr Beschwerdefreiheit einen Rückfall hatten. Das ist frustrierend, aber nicht ungewöhnlich.
Meine Strategie für Rückfallprävention beginnt mit realistischen Erwartungen. Ich erkläre: „Sie werden nicht für immer angstfrei sein. Aber Sie haben jetzt die Werkzeuge, um mit Angst umzugehen.” Wir entwickeln einen Notfallplan – was zu tun ist, wenn Angstsymptome zurückkehren. Spoiler: Die Antwort ist fast immer „sofortige Mini-Exposition.”
Auffrischungssitzungen plane ich routinemäßig. Nach Therapieende sehen wir uns nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr. Diese Check-ins fangen frühe Warnzeichen ab. Ein Patient mit Flugangst flog zwei Jahre problemlos, dann wurde ein Flug turbulent. Eine Auffrischungssitzung verhinderte die Rückkehr zur vollständigen Vermeidung.
Ich empfehle auch regelmäßige „Erhaltungsexposition”. Wer Höhenangst überwunden hat, sollte gelegentlich Höhen aufsuchen – nicht aus Notwendigkeit, sondern zur Aufrechterhaltung des Extinktionslernens. Das Gehirn braucht Erinnerungen daran, dass die Situation sicher ist. Ein Patient besucht alle paar Monate einen Aussichtsturm, einfach als „Angstprävention.”
Die langfristigen Daten sind ermutigend. Studien zeigen, dass 70-80% der Patienten ihre Gewinne über fünf Jahre halten. Von denen, die Rückfälle erleben, sprechen die meisten gut auf kurze Auffrischungsinterventionen an. Die Investition in Expositionstherapie zahlt sich also langfristig aus.
Fazit
Nach all den Jahren in der Praxis bleibe ich dabei: Expositionstherapie bei Angststörungen ist die wirksamste Einzelintervention, die wir haben. Ist sie einfach? Nein. Ist sie angenehm? Definitiv nicht. Aber funktioniert sie? Die Forschung und meine klinische Erfahrung sagen eindeutig ja. Was mich immer wieder beeindruckt, ist die Transformation, die ich bei Patienten erlebe – von lähmender Angst zu kontrolliertem Unbehagen zu echter Freiheit.
Die Expositionstherapie ist kein magisches Heilmittel. Sie erfordert Mut, Engagement und oft therapeutische Unterstützung. Aber für die meisten Menschen mit Angststörungen ist sie der Goldstandard aus gutem Grund. Wenn ich einem Freund oder Familienmitglied mit Angst einen Rat geben müsste, wäre es: Finde einen qualifizierten Therapeuten, der Expositionstherapie anbietet, und gib ihr eine ehrliche Chance.
Die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe: Angst zu überwinden bedeutet nicht, sie zu eliminieren. Es bedeutet, ihr die Macht zu nehmen, Ihr Leben zu kontrollieren. Und genau das leistet die Expositionstherapie bei Angst besser als jeder andere Ansatz, den ich kenne. Die Zukunft liegt in personalisierten Expositionsprotokollen, VR-Integration und besserer Rückfallprävention. Aber die Grundprinzipien – kontrollierte, wiederholte Konfrontation mit dem Gefürchteten – werden Bestand haben, weil sie auf fundamentalen Lernprinzipien basieren.
Was kostet eine Expositionstherapie
Die Kosten variieren stark je nach Setting und Land. In Deutschland übernehmen gesetzliche Krankenkassen in der Regel die Kosten für ambulante Verhaltenstherapie, einschließlich Expositionstherapie, nach Genehmigung. Private Sitzungen können zwischen 80-150 Euro kosten. Bei Kassenzulassung entstehen meist nur Praxisgebühren. Die Gesamttherapie umfasst typischerweise 20-40 Sitzungen, wobei spezifische Phobien oft mit weniger Sitzungen auskommen.
Wie lange dauert eine Expositionstherapie
Die Dauer ist individuell verschieden. Bei spezifischen Phobien sehe ich oft Erfolge nach 6-12 Sitzungen über 8-12 Wochen. Komplexere Angststörungen wie soziale Phobie oder PTBS erfordern häufig 15-25 Sitzungen über 4-6 Monate. Jede Sitzung dauert typischerweise 50-90 Minuten. Die Geschwindigkeit hängt von Schweregrad, Motivation und zwischen-sitzungs Übungen ab. Intensive Programme bieten manchmal verkürzte Zeitrahmen mit mehreren Sitzungen pro Woche.
Ist Expositionstherapie gefährlich
Nein, bei korrekter Durchführung ist Expositionstherapie sicher. Kurzfristig erhöht sich zwar die Angst während Expositionen – das ist beabsichtigt und therapeutisch notwendig. Die größte „Gefahr” ist vorzeitiges Abbrechen, was Angst verstärken kann. Deshalb ist professionelle Begleitung essentiell. Kontraindikationen bestehen bei akuten Psychosen, schweren Depressionen mit Suizidalität oder Substanzabhängigkeit. Ein qualifizierter Therapeut erstellt vorher ein Risikoprofil und passt die Exposition individuell an.
Kann man Expositionstherapie alleine durchführen
Theoretisch ja, praktisch rate ich stark davon ab. Selbstexposition ohne therapeutische Anleitung birgt Risiken: falsche Dosierung, zu frühes Abbrechen, Überforderung oder Unterforderung. Diese Fehler können Angst verschlimmern statt verbessern. Bei leichten spezifischen Ängsten können Selbsthilfebücher mit strukturierten Expositionsplänen hilfreich sein. Aber bei diagnostizierten Angststörungen ist professionelle Begleitung der Goldstandard. Ein Therapeut justiert den Plan, motiviert bei Rückschlägen und verhindert typische Fehler.
Hilft Expositionstherapie bei Panikattacken
Absolut, Expositionstherapie ist hocheffektiv bei Panikstörung. Wir nutzen zwei Ansätze: interozeptive Exposition (gezielte Auslösung von Körpersymptomen wie Herzrasen oder Schwindel) und situative Exposition (Konfrontation mit Orten, wo Panikattacken auftraten). Patienten lernen, dass die Symptome zwar unangenehm, aber nicht gefährlich sind. Die Erfolgsrate liegt bei etwa 70-80%. Kombiniert mit kognitiver Umstrukturierung – Hinterfragen katastrophaler Fehlinterpretationen – sind die Langzeitergebnisse ausgezeichnet.
Was passiert während einer Expositionssitzung
Eine typische Sitzung beginnt mit Vorbesprechung: Angstniveau-Check, Zielsetzung, Erinnerung an Bewältigungsstrategien. Dann erfolgt die eigentliche Exposition – zum Beispiel Fahrstuhlfahren bei Klaustrophobie. Ich begleite den Patienten, monitore kontinuierlich das Angstniveau (0-100 Skala) und ermutige zum Durchhalten bis die Angst sinkt. Nach der Exposition besprechen wir die Erfahrung: Was wurde gelernt? Wie fühlte sich der Angstrückgang an? Abschließend planen wir Hausaufgaben für die kommende Woche.
Gibt es Alternativen zur Expositionstherapie
Ja, aber mit Einschränkungen bezüglich Wirksamkeit. Kognitive Therapie ohne Exposition hilft bei Angst, ist aber oft weniger effektiv. Medikamente (SSRIs, Benzodiazepine) lindern Symptome, heilen aber nicht die Ursache. Entspannungsverfahren und Atemtechniken sind unterstützend, nicht kurativ. EMDR zeigt bei PTBS Erfolge. Akzeptanz- und Commitment-Therapie integriert Expositionselemente anders. Realität aus meiner Praxis: Für Phobien und viele Angststörungen ist Exposition der evidenzbasierte Goldstandard. Alternativen funktionieren, aber meist langsamer und weniger vollständig.
Funktioniert virtuelle Realität bei Expositionstherapie
Ja, VR-Expositionstherapie zeigt beeindruckende Ergebnisse. Besonders bei Flugangst, Höhenangst und sozialen Phobien ist sie fast so effektiv wie reale Exposition. Vorteile: kontrollierbare, wiederholbare Szenarien ohne logistischen Aufwand. Ein Flugangstpatient kann zwanzigmal virtuell fliegen, bevor ein echter Flug ansteht. Nachteile: weniger intensiv als reale Exposition, Technologiekosten. In meiner Praxis nutze ich VR als Zwischenschritt – virtuell ü